Aktuelles
& Rechtstipps
VERTRAGSrecht: Gewährleistungsausschluss bei Verbrauchern
Was bei einem Gewährleistungsausschluss bei Verträgen zwischen Verbrauchern zu beachten ist
Eine Modernisierung des Schuldrechts führt zu Änderungen in den Möglichkeiten, eine Gewährleistungspflicht vertraglich auszuschließen. Beim Kauf eines Verbrauchsgutes sind Klauseln, die eine Haftung ausschließen, größtenteils unwirksam (§ 475
Abs. 1 S. 1 BGB).Liegt kein Verbrauchsgüterkauf vor, können die Parteien weiterhin die
Käuferrechte ausschließen.
Verbraucher untereinander können daher ihre
Gewährleistungsrechte in vollem Umfang verlieren bzw. haben die
Möglichkeit, sich von den Gewährleistungspflichten freizuzeichnen.
Wann ist ein Haftungsausschluss zulässig und was müssen die Parteien dabei beachten?
Voraussetzungen eines Haftungsausschlusses
Eine Vereinbarung über die Freizeichnung der Haftung ist dann erforderlich, wenn kein gesetzlicher Haftungsausschluss (z.B. § 377 Abs. 2 HGB oder §§ 445 , 442 BGB) greift. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies ausdrücklich oder stillschweigend geschieht . Maßgeblich ist vielmehr der Zeitpunkt der Vereinbarung, denn es ist auch möglich, diese erst nach dem Abschluss des Vertrags zu treffen. (Palandt-Putzo, BGB, 64. Aufl., § 444, Rn. 6).
Individualvertraglicher Haftungsausschluss
Es besteht die Möglichkeit, vertragliche Abreden über einen Ausschluss der Gewährleistungshaftung individualvertraglich zwischen den Parteienzu vereinbaren oder durch AGB in den Vertrag einzubeziehen. Unsicherheiten bei der möglichen Zulässigkeit von individuell vereinbarten Haftungsausschlussklauseln sind gem. §§ 138 , 242 BGB auszulegen, zum Unfang nach §§ 133 , 157 BGB. Im Zweifel erfolgt die Auslegung zu Gunsten des Käufers. (Palandt-Putzo, a.a.O., § 444, Rn. 15).
Ausdrücklicher Gewährleistungsausschluss
Achtung: Bei vorsätzlichem Handeln kann eine Haftung nicht ausgeschlossen werden, allerdings führt auch dies nicht zur vollständigen Unwirksamkeit des Gewährleistungsausschlusses. In einem solchen Fall kann eine ergänzende Ersatzklausel aufgenommen werden, so dass dann der Verkäufer nur für den von ihm vorsätzlich verursachten Schaden zur Haftung verpflichtet wird. (§ 276 Abs. 3 BGB; BGH NJW 84, 1177 ; Tiedtke/Burgmann, NJW 05, 1153)
Eine Haftungsbeschränkung kann auch stillschweigend erfolgen. Dies geschieht entweder durch das Verhalten der Parteien beim Abschluss des Vertrages ("Freundschaftspreis") oder durch konkrete Anhaltspunkte für einen konkludenten Verzicht der Gewährleistungsrecht nach der Verkehrssitte bzw. dem Vertragstext. (MüKo-Westermann, § 444 BGB, Rn. 5). Hier sind als Beispiele der Schluss- oder Aktionsverkauf, Kauf von Ramsch oder der Kauf von umfangreichen Sammlungen anzuführen. Hier geht man davon aus, dass der Käufer auf seine Gewährleistungsrechte verzichtet (OLG Stuttgart NJW 69, 610).
Auch bei Verträgen zwischen Verbrauchern besteht die Möglichkeit des Haftungsausschlusses durch eine Verrwendung von AGB, die eben nur einmalig zur Anwendung kommen. Voraussetzung ist, Klauseln zu verwenden, die für einen mehrfachen Gebrauch formuliert wurden (BGH VK 05, 198, Abruf-Nr. 052610 ), zum Beispiel durch die Nutzung von Formularverträgen oder Vorlagen aus dem Internet. (Tiedtke/Burgmann, NJW 05, 1153, 1157).
Für die Wirksamkeit der in AGB eingefügten Haftungsausschlussklauseln sind §§ 307 bis 309
BGB maßgeblich. Hier gibt es zwei wesentliche Unterschiede:
- neu hergestellte Sachen
Die Regelung des § 309 Nr. 8b BGB (Zulässigkeitsvoraussetzung für Klauseln, die sich auf die Nacherfüllung, den Rücktritt und die Minderung bei Lieferungen neu hergestellter Sachen und Werkleistungen beziehen), hat dementsprechend eine geringe Bedeutung der Vorschrift zur Folge.
- gebrauchte Sachen
§ 309 Nr. 7a und 7b BGB.
Nach § 309 Nr. 7a BGB ist ein Haftungsausschluss der sich auf einen Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bezieht, unwirksam. Ebenso gilt dies gemäß § 309 Nr. 7b BGB auch für alle sonstigen Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass nach § 309 Nr. 7aund 7b BGB nicht nur ein Haftungsausschluss, sondern auch jede Haftungsbeschränkung unzulässig ist (z.B. eine summenmäßige Beschränkung oder der Ausschluss nur bestimmter Schäden; BGH NJW 87, 2820).
In § 437 BGB ist ein Schadenersatzanspruch verankert, bei dem zwischen Mangelschäden und den Mangelfolgeschäden, zu unterscheiden:
Mangelschaden
(Schaden an der Sache selbst)
- Hier kommt gem. § 280 Abs. 1und 3, § 281 BGB ein Haftungsausschluss lediglich bei leichter Fahrlässigkeit in Betracht.
Mangelfolgeschaden (Schaden außerhalb der Kaufsache und alle sich daraus ergebenden Vermögensnachteile)
- Handelt es sich um einen solchen Schadenersatzanspruch nach § 280
Abs. 1 BGB, wird vertreten, dass die Grenze der unangemessenen Benachteiligung gem. § 307
Abs. 2 Nr. 2 BGB zu berücksichtigen ist (Tiedtke/Burgmann, NJW 05,
1153; a.A. Stölting, ZGS 05, 299). Das heißt, dass sich ein typischer, vorhersehbarer
Schaden, für den die Haftung durch leichte Fahrlässigkeit gilt, nicht auf die Erfüllung wesentlicher Vertragspflichten
beziehen darf (BGH NJW 02, 673
). Ausschlaggebend ist hier die zugrundeliegende Vertragsart: Bei einem Kaufvertrag zum Beispiel stellt die Verschaffung des
Besitzes und des Eigentums an einer mangelfreien Sache die wesentliche
Pflicht dar (v. Westphalen, NJW 03, 12; Arnold, ZGS 04, 16). Dies
bedeutet aber nicht, dass sich die Bestimmung der Kardinalpflichten
zwingend aus den Hauptleistungspflichten ergeben muss. Vielmehr geben
diese lediglich einen Hinweis (BGH NJW 02, 673
; Müko-Basedow, § 309
BGB, Rn. 26).
| Folgende gängige Klauseln können verwendet werden, um sich als Verbraucher von der Verpflichtung zur Gewährleisgung freizustellen: „gekauft wie gesehen“, „gekauft wie besichtigt und Probe gefahren“
Bei einem Kaufvertrag über einen Gebrauchtwagen zwischen Privatpersonen, in dem ein formularmäßiger Ausschluss jeder Gewährleistung enthalten ist, so wird dieser nicht durch den handschriftlichen Zusatz „gekauft wie gesehen“ eingeschränkt ( BGH 6.7.05, VIII ZR 136/04, Abruf-Nr. 052571 ). „wie besichtigt/gesehen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung“
Der Zusatz „..unter Ausschluss jeglicher
Gewährleistung...“ bezieht sich den Haftungsausschluss auch bei verborgenen Mängeln (MüKo-Westermann, § 444
BGB, Rn. 7) und spielt speziell im Gebrauchtwagenhandel und beim Kauf von Altbauten eine Rolle (BGH NJW 86, 2824
).
Bei neu herzustellenden Sachen oder bei noch zu errichtenden Gebäuden
wird einem solchen generellen Ausschluss dagegen die Wirksamkeit
abgesprochen (BGH NJW 84, 2094
; Palandt-Putzo, a.a.O., § 444, Rn. 18).
„wie die Sache steht und liegt“ ist eine gängige Formulierung im Immobiliengeschäft. Der entscheidende Unterschied zu "gekauft wie besichtigt" ist, dass es eben nicht auf die Besichtigung des Käufers ankommt, sondern dass die Kaufsache so akzeptiert werden muss, wie sie ist. ( MüKo-Westermann, § 444 BGB, Rn. 7) Somit sind in der Regel hier auch verborgene Mängel vollständig von der Haftung ausgeschlossen (Palandt-Putzo, a.a.O., § 444, Rn. 18).
Es gibt hier allerdings Besonderheiten beim notariellen Grundstückskauf denn hier hat der BGH bei der Verwendung von Standardformulierungen und Mustertexten strengere Voraussetzungen aufgestellt . Demnach ist ein Ausschluss der Käuferrechte nur dann zulässig, wenn der Notar die Klausel des Haftungsausschlusses den Parteien nicht nur vorliest, sondern auch eingehend und nicht nur formelhaft erörtert (BGH NJW 76, 515 ; Litzenburger, NJW 02, 1244). |
Quelle: IWW Institut; www.iww.de ; Ausgabe 12 / 2005 Seite 201 | ID 94560;
Mitgeteilt von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Martin J. Warm Martin J. Warm Martin J. Warm , Paderborn ( www.warm-wirtschaftsrecht.de )
Tipp: Sprechen Sie vorab mit uns, wenn Sie Sachverhalte haben, in denen Sie entweder einen hochwertigen Gegenstand privat verkaufen oder kaufen möchten. Wir können gemeinsam einen für Sie sicheren Vertrag erstellen, Ihren bereits vorliegenden Vertrag prüfen und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Wir zeigen Ihnen gern Möglichkeiten und Alternativen auf!
Ihr Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Martin J. Warm , Schwerpunkt Vertragsrecht
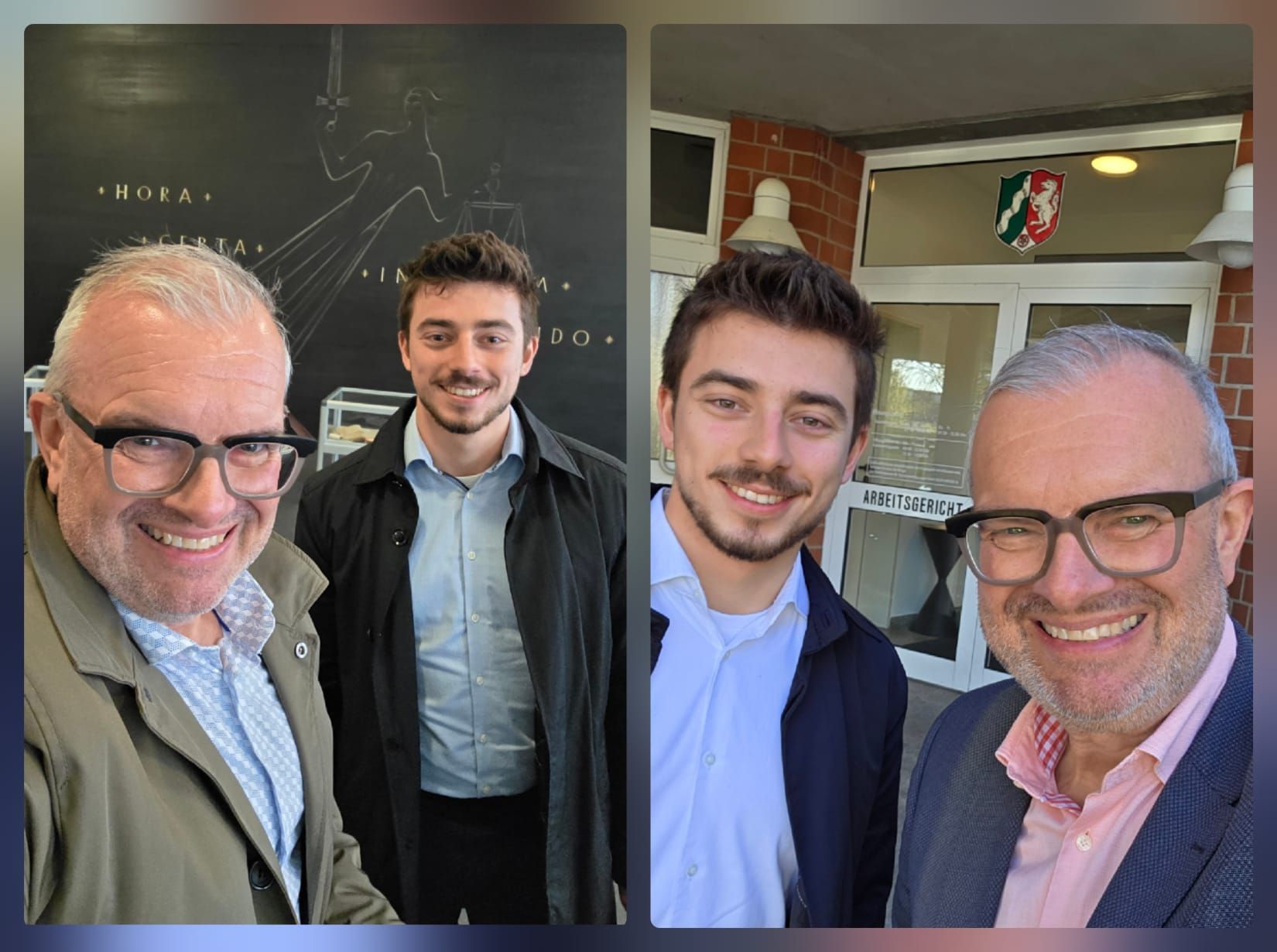
KANZLEIintern: Praktikum bei Warm und Kollegen: „Einblicke, die man im Jurastudium so nicht bekommt“










